Nachrichten aus dem Zentrum Wald-Forst-Holz - LWF aktuell 151
Das Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan - bestehend aus der Studienfakultät für Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement der TU München, der Fakultät Wald und Forstwirtschaft der HSWT und der Bayrischen LWF - vereint Forschung, Lehre und Beratung an einem Standort und bildet den Knotenpunkt forstlicher Kompetenz in Bayern.
Die neuesten Nachrichten und Informationen aus dem ZWFH finden Sie auf dieser Seite. Die Nachrichten aus dem Zentrum erscheinen auch stets in der jeweiligen Ausgabe der LWF aktuell.
Erasmus+ verbindet mit der Ukraine
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Die ukrainische Delegation mit dem Geschäftsführer des ZWFH. (© J. Hiller, ZWFH)
Im Rahmen des Erasmus+ Mobilitätsprogramms besuchten Wissenschaftler der National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NULES) die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT), um Fachwissen über nachhaltige Forstwirtschaft un-ter den Herausforderungen des Klimawandels auszutauschen. Die ukrainische Delegation - Prof. Dr. Andrii Bilous, Dr. Oleksandr Lesnik, und Dr. Roman Zadrozhniuk - erkundete gemeinsam mit HSWT-Professoren die Lehrwälder der HSWT (Waldbewirtschaftungsplanung) und den Nationalpark Bayerischer Wald (Schutzgebiete, Totholzökologie, Waldpädagogik). Dr. Karl-Heinz Häberle (TUM) stellte Erkenntnisse aus dem KROOF-Projekt zu Trockenstressversuchen vor. Herbert Rudolf von den BaySF führte die Gruppe durch den Weltwald Freising (Biodiversität, Ästhetik, Kommunikation mit der Gesellschaft).
Ein wichtiges Treffen im Zentrum Wald-Forst-Holz zeigte die Partnerschaft zwischen HSWT, TUM und LWF. Der Besuch umfasste auch ein Seminar über die Auswirkungen des Krieges auf die Wälder der Ukraine mit einem beeindruckenden Vortrag von Prof. Dr. Andrii Bilous. Als Ergebnis wurden neue Schritte skizziert, um die zukünftige Zusammenarbeit und den akademischen Austausch zwischen der HSWT und NULES zu stärken.
Dr. Svitlana Bilous, HSWT
Weihenstephaner Forsttag 2024: Die Lebensadern der Forstwirtschaft neu betrachtet
Mit über 130 Teilnehmern und zehn Fachreferenten aus unterschiedlichsten Bereichen fand am 8. November 2024 der 34. Weihenstephaner Forsttag statt. Unter dem Titel „Die Lebensadern der Forstwirtschaft neu betrachtet" widmete sich die renommierte Veranstaltung dem Spannungsfeld zwischen Forstwirtschaft, Naturschutz und den steigenden gesellschaftlichen Ansprüchen an unseren Wald.
Fachlicher Austausch auf höchstem Niveau
Durch das abwechslungsreiche Programm führten Florian Rauschmayr und Dr. Michael Jeschke, die den Tag mit ihrem Fachwissen und einer klaren Moderation begleiteten. Teilnehmer aus Wissenschaft, Verbänden, Praxis und Forstverwaltungen diskutierten gemeinsam über aktuelle Herausforderungen und innovative Ansätze rund um das Thema Forstwege.
Vielfältige Programmpunkte und hochkarätige Referenten
Die Jagdhornbläser der Fakultät für Wald und Forstwirtschaft eröffneten die Veranstaltung musikalisch. Prof. Dr. Eric Veulliet, Präsident der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, und Prof. Dr. Jörg Ewald, Dekan der Fakultät Wald und Forstwirtschaft begrüßten die Teilnehmenden, auf die ein breites Spektrum an Fachvorträgen und Diskussionsrunden wartete:
- Maximilian Leutenbauer, Wegebauberater am AELF Holzkirchen, eröffnete mit einem Rückblick auf 30 Jahre Forstwegebau in Bayern.
- Florian Hofinger, AELF Passau, analysierte das Sturmgeschehen in Passau und dessen Auswirkungen auf die Forstwegeplanung.
- Bernd Flechsig (Sachsenforst) beleuchtete die Themen Wegepflege und Wegebau in Sachsen.
- Prof. Erik Findeisen (Fachhochschule Erfurt) stellte das Contura-System zur automatisierten Zustandserfassung forstlicher Wege vor.
- Johannes Volkmer, (ÖKOTEAM – Institut für Tierökologie und Naturraumplanung) sprach über die biologische Vielfalt an Forststraßen.
- Dr. Julian J. Zemke (Universität Koblenz) präsentierte Erkenntnisse zu Oberflächenabfluss und Bodenabtrag auf Wirtschaftswegen in Wäldern.
- Hans Kirchmeir (E-C-O Institut) diskutierte die Frage, ob Österreichs Forstwege eine Übererschließung darstellen.
- Gudula Lermer (Betriebsleiterin bei den Bayerischen Staatsforsten) thematisierte den Spagat zwischen Bewirtschaftung, Presse und Erholungsdruck.
- Sonja Schreiter (Deutsche Initiative Mountainbike e.V.) stellte Konzepte zur Lenkung von Mountainbikern durch bedarfsgerechte Wegeinfrastruktur vor.
- Prof. Dr. Marius Mayer (Hochschule München) beleuchtete nachhaltige Besucherlenkung im Kontext von Tourismus und Waldnutzung.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Dekan der Fakultät Wald und Forstwirtschaft der HSWT spricht auf dem Weihenstephaner Forsttag. (© HSWT)
Ein gut ausgebautes Wegenetz ist essenziell für die nachhaltige Nutzung von Wäldern, die Biodiversität und die Erholung der Bevölkerung. Die Diskussionen und Erkenntnisse des Tages unterstrichen die Dringlichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen und dabei die vielfältigen Funktionen der Wälder zu berücksichtigen.
HSWT
Vierte Bundeswaldinventur füllt gleich zwei Hörsäle
Über 300 Zuschauerinnen und Zuschauer in zwei Hörsälen der HSWT und online interessierten sich Ende November 2024 für die Podiumsdiskussion zur vierten Bundeswaldinventur. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Hochschulgruppen des Jungen Netzwerk Forst (JNF) und der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW). Zur Diskussion wurden eingeladen: Prof. Dr. Knoke (TUM), Prof. Dr. Rothe (HSWT), Dr. Straußberger (BUND), Präsident Dr. Pröbstle und Herr Stöger (beide LWF). Wolfgang Stöger gab als zuständiger Inventurleiter in Bayern zunächst einen Überblick über die Hintergründe der Inventur, bevor die fünf Fachleute den Abend für einen kurzweiligen Austausch über die Bedeutung der Ergebnisse für die Kohlenstoffspeicherung, den Wald in Bayern allgemein und natürlich auch für den Naturschutz nutzten.
Maja Bosch, ZWFH
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf veranstaltet Round Table zu Jagd und Jagdpraxis
Am 18. Dezember 2024 diskutierten ca. 180 Forststudierende beim Round Table unter der Moderation von Dr. Martina Hudler, Wildbiologin und Dozentin für Jagdlehre und Wildtiermanagement an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, mit Fachleuten über verschiedene Perspektiven der modernen Jagdpraxis. Der Jagd-Round-Table hat sich 2021 als jährliche Tradition an der Fakultät Wald und Forstwirtschaft etabliert.
Dr. Hudler freute sich, eine beeindruckende Reihe von Fachleuten zur Podiumsdiskussion begrüßen zu dürfen. Im Fokus der Diskussion standen Jagdethik, jagdtechnische Aspekte aber auch die Jagdpraxis an sich. Die Festlegung von vier zentralen Themenschwerpunkten (Jagdethik im Zeitalter der Technik, Jagdstrategie in Sanierungsgebieten, Anpassung von Schonzeiten und zeitgemäße Raubwildjagd) erfolgte durch die Studierenden.
Im Themenbereich Jagdethik wurde der Einfluss von Nachtsichtgeräten und Wärmebildtechnik auf die Jagd beleuchtet, wobei besonders der Verlust des handwerklichen Aspekts und die Fairness gegenüber Wildtieren im Mittelpunkt der Diskussion standen. Mögliche Jagdstrategien in Sanierungsgebieten wurden als weiterer Schwerpunkt diskutiert. Die Vereinbarkeit von Wald und Tierschutz in sensiblen Gebieten (z. B. Gebiete mit Auerwildvorkommen) sowie die Bedeutung von Schonzeitaufhebungen standen im Fokus dieses Themenbereiches. Weiter wurde über die Anpassung von Schonzeiten gesprochen und die Notwendigkeit betont, diese an die Lebenszyklen der Wildtiere anzupassen. Den vierten Themenschwerpunkt bildete die Frage, ob Raubwildjagd noch zeitgemäß ist. Die Notwendigkeit der Raubwildbejagung wurde bejaht, während die Baujagd kritisch betrachtet wurde.
Die Diskussion ermöglichte einen offenen Austausch, in dem die Teilnehmenden ihre Sichtweisen darlegten und die Themen der Studierenden vertieften. Dr. Hudler betonte: „Es ist wichtig, Wissen zu vermitteln und den Dialog zu fördern, um eine neue Generation von Forst- und Jagdexpertinnen und -experten zu befähigen, fundierte Entscheidungen zu treffen." Die Veranstaltung lieferte wertvolle Impulse. Alle waren sich einig, dass der interdisziplinäre Austausch zwischen Theorie und Praxis essenziell für eine nachhaltige Jagd ist. Der wertschätzende Umgang trotz unterschiedlicher Meinungen wurde sehr begrüßt.
HSWT
HSWT-Studierende pflanzen eine multifunktionale Streuobstwiese
Anfang November 2024 konnten Studierende des 3. Semesters im Studiengang Arboristik und Urbanes Waldmanagement ihr erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen. Dank Spenden des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und von Privatpersonen sowie der Unterstützung durch die Fakultät Wald und Forstwirtschaft der HSWT wurden rund 50 verschiedene Bäume gepflanzt. Damit wurde der Grundstein für den „Grünen Hörsaal" für diesen zukunftsweisenden Studiengang gelegt – ein lebendiger und baumgeprägter Lernort.
Das Studienprojekt dient der Entwicklung von Kommunikations- und Projektmanagementfertigkeiten. Zudem vereint es praxisnahe Lehre und den Erhalt der biologischen Vielfalt. Die Studierenden sind von der Projektplanung über die Pflanzung bis hin zur Pflege und langfristigen Erhaltung eingebunden. Die entstandene Streuobstwiese bereichert das Landschaftsbild und ist ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und dem Erhalt unserer Kulturlandschaft. Die Initiative zeigt, wie naturnahe Projekte vielfältige Ziele in Bildung, Forschung und Umweltschutz vereinen können.
Prof. Dr. Jörg Ewald, Dekan der Fakultät Wald und Forstwirtschaft, begrüßte die Gäste und betonte: „Für mich ist das ein Herzensprojekt. Die Pflanzung der Streuobstwiese schafft Verbindungen zwischen offener Landschaft und Wald, zwischen Studierenden und Gesellschaft, zwischen Hochschule und Kommunen."
In ihrem Grußwort zeichnete Studiendekanin Prof. Dr. Barbara Darr eine Vision für die Zukunft: „Für mich ist die Streuobstwiese ein wunderbarer Ort, theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen und den Studiengang ein lebendiges und bleibendes Zeichen setzen zu lassen. Ich hoffe, dass viele Studierendenjahrgänge das Werk fortsetzen – pflanzend, Obstbäume schneidend, Feste feiernd oder später bei der Ernte und Verarbeitung von Früchten."
Rosa Sahin brachte für die Studierenden zum Ausdruck, wie spannend es sei, ein Projekt zu entwickeln, in die Umsetzung zu bringen und es in den ersten Jahren aktiv mitgestalten zu können.
Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher betonte aus Sicht der Stadt Freising: »Der Studiengang Arboristik und urbanes Waldmanagement ist ein zukunftsweisender Studiengang. Die Stadt Freising setzt sich mit dem Klimawandel aktiv auseinander.« Und die Pflanzung von Bäumen gehöre explizit zum Klimaanpassungskonzept der Stadt.
Katrin Hirseland, Vizepräsidentin des BAMF Nürnberg, überzeugte sich vor Ort von der Spendenverwendung und zeigte sich beeindruckt: „Jeder Baum, den wir hier pflanzen, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Theorie in die Praxis umgesetzt werden kann. Das ist nicht nur ein symbolischer Akt, sondern auch ein greifbarer Beitrag zur Verbesserung unserer Umwelt. Diese Bäume werden Lebensräume für Tierarten schaffen, die Biodiversität fördern und das Klima positiv beeinflussen."
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Studierende binden einen frisch gepflanzten Obstbaum an. (© J. Hiller, ZWFH)
Allgemein sind Streuobstwiesen mit ihrer Vielfalt nicht nur wertvolle Kulturgüter, sondern auch lebendige Orte der Arterhaltung. Mit dem Anbau verschiedener Obstsorten wie zum Beispiel der großen schwarzen Knorpelkirsche, der vermutlich ältesten Kirschsorte, sowie der bekannten Apfelsorte Bittenfelder wurden seltene, aber auch robuste Arten gewählt. Durch die Ergänzung mit anderen Wildobstarten wie dem Speierling und Baumarten wie Maulbeere und Esskastanie können Gene erhalten und die Biodiversität gesteigert werden. Die Streuobstwiese schafft zudem Lebensraum und bietet Nahrung für zahlreiche Insekten und Tierarten. Gleichzeitig sind die gewählten Baumarten robust gegenüber klimatischen Veränderungen und bieten in Zukunft vielleicht weitere Forschungsmöglichkeiten innerhalb des Studiengangs.
Nach der Pflanzung steht die Beobachtung des Anwuchserfolgs im nächsten Frühjahr auf dem Plan. In den ersten Sommern werden die Studierenden sicherstellen, dass die Bäume ausreichend Wasser erhalten. Zudem müssen Erziehungs- und Aufbauschnittmaßnahmen an den jungen Bäumen durchgeführt werden. Die weitere Pflege soll dann zunehmend von den Studierenden der nachfolgenden Semester übernommen werden, um irgendwann auch die Früchte dieser Arbeit ernten zu können.
Hintergrund zum Studiengang
Der Studiengang Arboristik und Urbanes Waldmanagement besteht seit Oktober 2023 an der HSWT und fokussiert sich auf Baum- und Waldbestände im städtischen Kontext. Das Themenspektrum reicht von der Planung über Baumpflege und Management bis hin zu Naturschutz und Besucherlenkung. Die Studieninhalte basieren auf den Säulen Ökologie, Ökonomie, Soziales und Technik. Im Gegensatz zur klassischen Forstwirtschaft steht bei der Arboristik nicht die Holzproduktion im Vordergrund, sondern die Erhaltung und Entwicklung der Leistungen von Bäumen im urbanen Raum.
Besondere Ökosystemleistungen der Bäume wie Kühlung durch Verdunstung und Schattenspende, Luftfilterung, Bereitstellung von Sauerstoff sowie Lärmschutz werden in Zeiten der Klimakrise eine noch wichtigere Rolle in unseren Städten als bisher spielen. Sie sind Grundlage unserer Lebensqualität, unseres Wohlbefindens und unserer Gesundheit. Zukünftige Berufsfelder für die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs liegen in der Baumpflege, der Baumkontrolle, dem Management von Baumbeständen in Kommunen oder einer Sachverständigentätigkeit im Arbeitsfeld Baumstatik.
HSWT
Neues aus dem A-DUR Projekt: REGULUS Statuskonferenz – Entscheiden unter Unsicherheit
Klimawandel, gesellschaftliche Transformationen, technologische Innovationen und ein fortwährender Wertewandel beeinflussen die Wald- und Holzforschung nachhaltig. Diese dynamischen Entwicklungen stellen die Forschung vor komplexe Herausforderungen, da bisherige Annahmen und Gewissheiten zunehmend hinterfragt werden. Angesichts langfristiger Transformationsprozesse in Wald- und Holzökosystemen sind flexible und adaptive Lösungsstrategien erforderlich. Gleichzeitig erfordert die Vielzahl an Einflussfaktoren und unvorhersehbaren Entwicklungen mutige Entscheidungen, die unter Unsicherheit getroffen werden müssen.
In diesem Spannungsfeld bieten Ansätze der „Unsicherheitsforschung" vielversprechende Impulse. Dies wurde auf der zweiten REGULUS-Statuskonferenz „Entscheiden unter Unsicherheit" thematisiert, die vom 8. bis 9. Oktober in Freiburg stattfand. Als bedeutender Standort der Wald- und Holzforschung bot Freiburg den idealen Rahmen für den interdisziplinären Austausch.
Zentrales Anliegen der Konferenz war es, Unsicherheiten im Bereich des Klimawandels, der Ressourcenverfügbarkeit und der Ökosystemleistungen zu analysieren und praxisorientierte Strategien zu entwickeln. Die Teilnehmenden aus Wissenschaft, Praxis und Politik arbeiteten gemeinsam daran, langfristige und nachhaltige Handlungsansätze für die Wald- und Holzwirtschaft zu entwickeln. Auch der REGULUS-Unterverbund A-DUR war auf der Konferenz durch den Projektleiter Prof. Dr. Peter Annighöfer (TUM) und die neue Projektkoordinatorin Dr. Anna-Katharina Eisen (Zentrum) vertreten, zusammen mit weiteren Forschungspartnern der TUM und der HSWT, darunter Prof. Dr. Annette Menzel, Dr. Gerd Lupp, Korbinian Tartler und Tobias Fuchs.
Der Austausch verdeutlichte, wie wichtig interdisziplinäre Zusammenarbeit ist, um Unsicherheiten in komplexen Systemen besser zu verstehen und Lösungen zu finden.
Dr. Anna-Katharina Eisen
Personalia

Dr. Anna-Katharina Eisen koordiniert Forschungsprojekt A-DUR
Seit 1. Oktober 2024 gibt es ein neues Gesicht am Forstzentrum: Dr. Eisen übernahm die Koordination des REGULUS-Projektes A-Dur, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird. Gemeinsam arbeiten Forschende der TUM, der HSWT und der LWF daran, Auwälder und deren Dynamik und Resilienz zu erforschen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, wie sich ein Nutzungsverzicht an der Mittleren Isar auf Natur und Gesellschaft auswirkt.
Frau Dr. Eisen erhielt 2016 ihren Mastertitel „Umweltprozesse und Naturgefahren" an der Katholischen Universi-tät Eichstätt-Ingolstadt und sammelte anschließend Berufserfahrung an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf am Campus Straubing. 2019 kehrte sie an die KU Eichstätt-Ingolstadt zurück, um als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Professur für Physische Geographie/Landschaftsökologie und nachhaltige Ökosystementwicklung zu arbeiten. Ihre Forschung beschäftigte sich vor allem mit den Auswirkungen des Eschentriebsterbens auf den Pollentransport und die Reproduktion von Fraxinus excelsior L.
Im Sommer 2023 schloss Dr. Eisen ihre Promotion, die vom Förderverein Auenzentrum Neuburg e. V. ausgezeichnet wurde, erfolgreich ab. Seit 2021 koordinierte sie zudem das Projekt FraxVir, das im Rahmen des bundesweiten Demonstrationsprojekts FraxForFuture durchgeführt wurde.
Mit ihrer umfangreichen Forschungserfahrung und ihrem breiten Fachwissen ist Dr. Anna-Katharina Eisen hervorragend aufgestellt, um das A-DUR-Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Annighöfer zu koordinieren und wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse zur Resilienz von Auwäldern zu gewinnen. Frau Dr. Eisen freut sich darauf, die fünf Doktorandinnen und Doktoranden bei ihrer Forschung zu unterstützen und ihnen ein breites Spektrum an Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln. Neben ihrer Rolle in der Projektkoordination wird Dr. Eisen in den kommenden Jahren auch ihre Habilitation anstreben.
Jakob Hiller
Beitrag zum Ausdrucken
Weiterführende Informationen
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
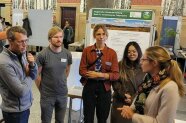 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden




