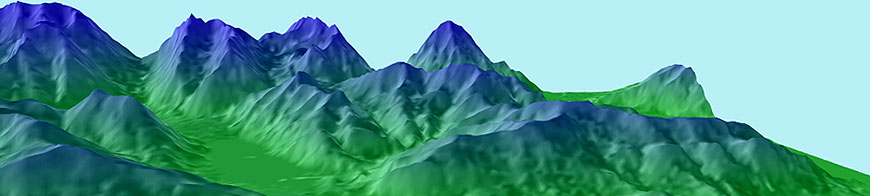LWF aktuell 154
Kronenschäden im Wald – mit KI und Fernerkundung zur großflächigen Erkennung
von Javier Gonzalez, Adelheid Wallner
Die vergangenen Trockenjahre haben in Nordbayern starke Schäden am Laubholz hinterlassen. Im Kurzprojekt BeechSAT (2019 bis 2020) wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, mit dem Ziel, aus unterschiedlichen Fernerkundungssensoren abgestorbene Laubholzkronen zu erfassen. Die positiven Ergebnisse bilden die Grundlage für das Folgeprojekt »ForstEO – Einsatz der Erdbeobachtung zur Erfassung von klimabedingten Schädigungen des Waldes in Deutschland«. Innerhalb des Projekts beschäftigen sich Forschende der LWF speziell mit der Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI).
Dabei wird insbesondere die Robustheit von KI-Modellen zur Identifikation von Kronenschäden aus Luftbilddaten und die Übertragbarkeit der KI-Modelle auf Luftbilddatensätze weiterer Regionen untersucht. Zu Beginn des Projektes ForstEO wurde eine Umfrage durchgeführt, um den Bedarf der Forstpraxis an Fernerkundungsprodukten zur Erfassung von Schäden im Wald zu ermitteln. Eine zentrale Rückmeldung aus der Praxis war, dass für die weitere Maßnahmenplanung zuverlässige Informationen zu Schadensort, -menge, -fläche und -zeitraum erforderlich sind (Wallner et al. 2025). Zusätzlich zeigte sich anhand der Befragung zur Schadensart, dass Trockenschäden sowohl im Laub- als auch im Nadelholz als ein wesentlicher Schadtyp wahrgenommen wurden.
Um diesen Bedarf zu decken, erforscht ForstEO den Einsatz von KI-Verfahren zur automatisierten, hochaufgelösten und flächendeckenden Erfassung von Kronenschäden an Laubbäumen. Dabei liegt der Fokus auf Methoden des »Deep Learnings (DL)«, welche auf tiefen, künstlichen neuronalen Netzen (Goodfellow et al. 2016) basieren.
Im Speziellen wurden CNN (Convolutional Neural Networks, LeCun et al. 2015) verwendet, die eine Objektabgrenzung sowohl mit spektralen Informationen als auch die Strukturmerkmale der Baumkrone nutzen. Hierbei wird das Ziel verfolgt, robuste und übertragbare Modelle zu entwickeln, die möglichst ohne weiteres Training auf neue Bilddaten gleicher räumlicher und spektraler Auflösung mit unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnissen und Aufnahmezeitpunkten übertragen werden können. Dadurch wird es uns möglich sein, Kronenschäden in anderen Regionen und Zeiträumen ohne größeren Aufwand erfassen zu können und die geschädigten Waldbereiche der Forstpraxis über das Bayerische Waldinformationssystem (BayWIS) zur Verfügung zu stellen.

Abb. 1: Beispiele abgestorbener Individuen von Buche (a), Eiche (b), Kiefer (c) und Fichte (d) (© J. Gonzalez, E. Reinosch; LWF)
Datengrundlage und Referenzdatenerzeugung
Zur Erfassung von Schäden auf Einzelbaum- oder Baumgruppenebene wurden Luftbilder verwendet. Die Bilddaten stammen aus Luftbildbefliegungen der LWF sowie aus amtlichen Befliegungen der bayerischen Vermessungsverwaltung (LDBV) mit 0,2 m räumlicher Auflösung in RGBI-Farbkanälen (Rot, Grün, Blau und nahes Infrarot). Die Abdeckung der Untersuchungsgebiete basiert auf einer Vielzahl von Bildflügen (Abbildung 2), die jeweils zwischen Mai und September in den Jahren 2019 bis 2023 durchgeführt wurden. Dabei kam es aufgrund unterschiedlicher Beleuchtungsverhältnisse durch Sonnenstand und Schattenwurf sowie verschiedener phänologischer Vegetationsstadien wie Blüte oder Herbstlaubverfärbung zu starken Inhomogenitäten im Bildmaterial.
| Datensatz | Quelle | Aufnahmedatum - Waldbrunn | Aufnahmedatum - Ebrach | Training | Validierung | Übertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDBV 2019-06 | LDBV | 26.06.2019 | 05./24.06.2019 | ✓ | ||
| LWF 2019-08 | LWF | 28.08.2019 | 28.08.2019 | ✓ | ✓ | |
| LWF 2020-05 | LWF | 18.05.2020 | 18.05.2020 | ✓ | ✓ | |
| LDBV 2021-09 | LDBV | 03.-09.09.2021 | 08./23.09.2021 | ✓ | ✓ | |
| LDBV 2023-05 | LDBV | 28.-29.05.2023 | 28.05.2023 | ✓ | ✓ |
Abb. 2.: Datengrundlage für die erstellten Trainings- und Validierungsdaten sowie der verwendete Datensatz zur Übertragung der Modelle
Insgesamt wurden vier Bilddatensätze (Abbildung 2) von zwei Untersuchungsgebieten zur Erstellung von Referenzdaten (Trainings- und Validierungsdaten) berücksichtigt (Gonzalez & Wallner 2025). Die Untersuchungsgebiete Waldbrunn (Fläche: 125 km²) und Ebrach (Fläche: 50 km²) liegen in Nordbayern, einer Region, die in den letzten Jahren stark von Trockenheit betroffen war (Straub et al. 2021). Dort befinden sich sowohl einzelne geschädigte Bäume als auch größere, zusammenhängende geschädigte Baumgruppen. Seit 2018 wurden erhebliche Schäden an Buche, Eiche, Kiefer und Fichte (Abbildung 1) festgestellt. Davon sind Laubbäume mit 84 % die häufigste Schadklasse in den Untersuchungsgebieten.
Zur genaueren Abgrenzung der Laubholzschäden wurde eine Aufschlüsselung der Kronenschäden in drei Kategorien vorgenommen:
- Kronenschäden an Bäumen
- Geschädigte Laub- und Nadelbäume
- Geschädigte Kiefer, Laub- und andere Nadelbäume
Damit robuste Modelle erzeugt werden können, ist für jede Kategorie eine ausreichend große Anzahl an qualitativ hochwertigen Referenzdaten aus Luftbildern unterschiedlichster Datenqualität und Aufnahmezeitpunkte zum Training eines DL-Klassifikationsmodells erforderlich. Für die Erzeugung des Referenzdatensatzes ist es notwendig, einen Luftbildinterpretationsschlüssel zur Abgrenzung der gewählten Kategorien zu erstellen. Bei der manuellen Erfassung der Kronenschäden wird die Gestalt und Form der Krone nach der VDI-Richtlinie 1993 betrachtet. Der Fokus lag dabei auf stehendem Totholz. Als Totholz wird holziges Material wie Stämme, Äste oder Zweige, die abgestorben sind, aber weitgehend die ursprüngliche Gestalt und Struktur beibehalten haben, definiert (Mosing et al. 2024). Hierzu zählen Teile der Krone oder ganze Kronen.
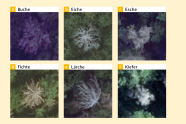 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 3: Aussehen der abgestorbenen Kronen ausgewählter Baumarten; oben sind die Laubbäume zu sehen (© LWF)
Die Referenzdaten werden am Stereoarbeitsplatz durch manuelle 3D-Digitalisierung abgegrenzt (Abbildung 6). Insgesamt konnten aus den vier unterschiedlichen Luftbilddatensätzen mehr als 28.000 Referenzpolygone generiert werden.
Anwendung von DL-Methoden
DL-Methoden werden zunehmend für Klassifizierungsaufgaben eingesetzt. Bei der Verarbeitung von Bilddaten kommen speziell Varianten des CNN (LeCun et al. 2015) wie U-Net (Ronneberger et al. 2015) zum Einsatz. U-Net- Methoden eignen sich besonders gut zur Identifizierung und Abgrenzung von Objekten in Bildern, da sie Farbinformationen sowie räumliche Strukturen der Objekte verwenden können. Außerdem bietet U-Net die sogenannte Semantische Segmentierung, bei der jedes Pixel des Eingabebildes einer entsprechenden Zielklasse zugeordnet wird.
Die KI-Modelle für die drei Kategorien wurden anhand der erzeugten Referenzdaten aus allen Jahren erstellt. Für die Validierung wurden die Modelle auf ein ausgewähltes Testgebiet innerhalb der Untersuchungsgebiete übertragen, die nicht für das Training verwendet wurden (Gonzalez & Wallner 2025). Zur Darstellung der Ergebnisse wird eine etablierte statistische Metrik, der F1-Score, verwendet. Der F1-Score bildet das harmonische Mittel aus Genauigkeit und Vollständigkeit und kombiniert damit diese beiden Maße in einer einzigen Metrik. Der Ergebniswert liegt zwischen 0 und 1, wobei höhere Werte besser sind.
| Anzahl der bewerteten Schadklassen | Schadensart | F1-Score (Training/Test) |
|---|---|---|
| 1 | Allgemein | 0,72 / 0,72 |
| 2 | Laubholz | 0,67 / 0,67 |
| Nadelholz | 0,72 / 0,59 | |
| 3 | Laubholz | 0,68 / 0,70 |
| Kiefer | 0,66 / 0,64 | |
| Nadelholz ohne Kiefer | 0,54 / 0,46 |
Abb. 4: F1-Scores für die bewerteten Kategorien. Getestet wurden drei Kategorien: Kronenschäden an Bäumen, Schäden an Laub- und Nadelbäumen sowie Schäden an Laubbäumen, Kiefer und andere Nadelbäume. Die F1-Scores werden für die Testfläche im Luftbild 2019 dargestellt.
Übertragbarkeit der Modelle
Um ihre Übertragbarkeit zu testen, wurde mit den Modellen ein unbekannter Bilddatensatz vom Juni 2019 (Abbildung 2) klassifiziert und ausgewertet. Abbildung 4 zeigt die erzielten F1-Scores für die getesteten Kategorien. Angesichts der hohen Heterogenität der verwendeten Bilddaten zeigen die F1-Werte gute Ergebnisse: Die Erfassung von Kronenschäden erreichte einen F1-Wert von 0,72. Die Trennung der Schäden in Laub- und Nadelbäume ergab etwas niedrigere F1-Werte von 0,67 bzw. 0,59. Bei der Aufteilung der Schäden in Laubbäume, Kiefer und andere Nadelbäume erreichten die F1-Werte unterschiedliche Güte (0,70, 0,64 bzw. 0,46). Nachbesserungsbedarf besteht jedoch noch in der Trennbarkeit von Kiefer zu anderen Nadelbäumen. Unsere Ergebnisse stimmen zudem mit den neuesten Studien von Cheng et al. (2024), Mosig et al. (2024), Möhring et al. (2025) und Schwarz et al. (2024) überein.
Einflussfaktoren bei der Schaderkennung
Ein robustes und übertragbares DL-Modell sollte gute Klassifizierungsergebnisse bei Verwendung unbekannten Bildmaterials liefern. Änderungen der Bildqualität und der Beleuchtungsverhältnisse im Bildinhalt könnten dabei eine Herausforderung darstellen.
Zu den technischen Faktoren, die die Verwendung robuster Modelle zur Schaddetektion erschweren können, gehören:
- Starke Veränderungen der Beleuchtungsverhältnisse während der Bildaufnahme, die eine Unter- oder Überbelichtung vom Bildinhalt verursachen.
- Schrägaufnahmen, die eine visuelle Verkippung der Bäume bewirken und ihr typisches Erscheinungsbild verändern.
- Schlechte Lichtverhältnisse sowie Schlagschatten im Kronendachbereich.
- Artefakte beim Erstellen von Orthophotomosaiken wie z. B. Verzerrungen von Objekten.
- Änderungen der Bildauflösung und Bildqualität.
Darüber hinaus können biotische Faktoren auftreten, die den eindeutigen Nachweis geschädigter Kronen verhindern. Beispiele hierfür sind:
- Entwicklung einer Sekundärkrone bei Laubbäumen (Buchen), die dem Baum ein falsches gesundes Aussehen verleihen.
- Zerfall der abgestorbenen Kronenteile, wodurch die Kompaktheit der Krone verringert wird.
- Bei offenen Totholzkronen können Variationen im Unterwuchs oder Bodenbereich – etwa unterschiedliches Unterholz, Holzreste, Bodenvegetation oder offener Boden – die Reflexionswerte zum Sensor beeinflussen (Möhring et al. 2025).
- Phänologische Veränderungen im Wald im Laufe des Jahres. So können gesunde Bäume aufgrund von Blüte oder Fruktifikation mit einer hellgrauen Krone erscheinen.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 5: Herausforderungen und Probleme bei der Erstellung von robusten DL-Modellen zur Schaddetektion. (© LWF)
Nicht weniger wichtig ist die Bildauflösung für die Ergebnisse. Studien von Mosig et al. 2024 haben gezeigt, dass mit höheren räumlichen Auflösungen bessere Ergebnisse erzielt werden können. Bei unserer Untersuchung wurde eine räumliche Bildauflösung von 20 cm verwendet, die für eine mögliche Unterscheidung zwischen geschädigten und vitalen Baumkronen bereits kritisch ist und dazu führen kann, dass kleine tote Kronenteile übersehen werden. Daher werden höhere Bildauflösungen (Pixel < 10 cm) empfohlen, deren Anwendung zur Abdeckung großer Flächen derzeit jedoch nicht realisierbar ist.
Herausforderungen und Weiterentwicklung der Modelle
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 6: Die Referenzdaten für die automatische Auswertung werden am Stereoarbeitsplatz durch manuelle 3D-Digitalisierung abgegrenzt. (© T. Hase)
Zusammenfassung
Die Erkennung von fernerkundungssichtbaren Kronenschäden an Laubbäumen unter Verwendung von KI ist Forschungsschwerpunkt der LWF im Projekt ForstEO. Erste Ergebnisse haben vielversprechende F1-Scores für die Erkennung von Schäden gezeigt. Es bestehen jedoch sowohl technische als auch biotische Herausforderungen, wie beispielsweise unterschiedliche Lichtverhältnisse, inhomogene Bildqualität, verschiedene phänologische Zeitpunkte oder die Ausbildung einer Sekundärkrone. Diese Faktoren könnten einen Einfluss auf die Übertragbarkeit der Modelle haben. Zusätzlich sollten die Luftbilddaten die gleiche räumliche und spektrale Auflösung besitzen wie die Daten, mit denen das Modell trainiert wurde. Die aufgezeigten Herausforderungen könnten über eine höhere Auflösung verringert werden, was in zukünftigen Forschungsprojekten untersucht werden muss. Erst nach erfolgreicher Untersuchung der Methodik kann der Ansatz in die Praxis überführt und das Produkt über BayWIS der Forstpraxis zur Verfügung gestellt werden.
Projekt
Das Projekt ForstEO wird von der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) mit den Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) über den Waldklimafond finanziert (Laufzeit: 01.03.2023–28.02.2026). Das Kooperationsprojekt wird koordiniert und geleitet durch das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum (DLR-DFD) am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Projektpartner sind unter anderem das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum (FFK) Gotha, die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA) und die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA-BW).
Beitrag zum Ausdrucken
Weiterführende Informationen
Autoren
- Dr. Javier Gonzalez
- Dr. Adelheid Wallner