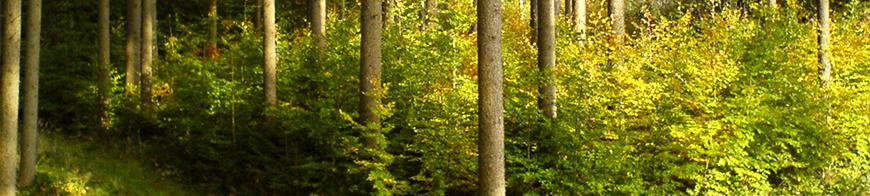LWF aktuell 151
Veränderung des Tangelhumus in den bayerischen Kalkalpen
von Roman Laniewski und Axel Göttlein
Humusschwund im bayerischen Alpenraum ist vor dem Hintergrund steigender Temperaturen kein Thema, das vernachlässigt werden kann. Besonders kritisch sind dabei die Fels-Humus-Böden, da hier die mächtige Humusauflage (Tangelhumus) das alleinige Bodensubstrat darstellt. Humusabbau gefährdet auf diesen Standorten die Waldfähigkeit, was auf Schutzwaldstandorten eine besondere Brisanz entwickelt.
Klimawandel, Sturmereignisse, Starkregen und Borkenkäfer gefährden unsere Bergwälder. Für die besonders klimasensitiven Tangelhumusstandorte im Alpenraum liegen bisher kaum Informationen vor, wie sich diese Ereignisse auswirken. Grundsätzlich geht es darum, wie sich die Mächtigkeit der Tangelhumusauflagen im bayerischen Alpenraum im Klimawandel verändert und ob Humusschwund stattfindet. Besonders auf Kalk- und Dolomitstandorten stellen Humusauflagen oft den wichtigsten, teilweise auch den einzigen Nährstoff- und Wasserspeicher dar. Die kühlen und feuchten Bedingungen im bayerischen Alpenraum wirken stabilisierend auf diese Humusauflagen. Doch was passiert mit diesen organischen Böden, wenn die Temperaturen im Rahmen des Klimawandels, von dem der Alpenraum besonders stark betroffen ist, weiter steigen?
Auswahl der Standorte und Aufbau der Humuspegel
Um die oben gestellte Frage zu beantworten, wurden in den Jahren 2020 und 2021 in den bayerischen Kalkalpen auf 27 Standorten im Staatswald insgesamt 405 Pegelstäbe zur Beobachtung der Entwicklung der Tangelhumusmächtigkeit eingebaut (Abbildung 1). Dies ermöglicht eine langfristige Dokumentation der Humusentwicklung. Kriterien für die Auswahl der Standorte waren unter anderem der Ost-West-Gradient, die Höhenlage, die Exposition und der Bestandestyp (Bergmischwald, Fichtenreinbestand, Kalamitätsfläche).
Innerhalb der Standorte wurden je 3 Kleinflächen, die ca. 3 bis 10 m voneinander entfernt liegen, ausgewählt. Pro Kleinfläche wurden 5 PVC-Stäbe so tief wie möglich im Boden versenkt und 10 cm über der Geländeoberfläche abgeschnitten. Ausgehend von einem Zentralstab wurde in jede Himmelsrichtung ein weiterer Stab in 80 cm Entfernung eingebaut. Bei der Wiederholungsaufnahme 2024, d. h. 3 bzw. 4 Jahre nach dem Einbau, wurde die Höhe der eingebauten PVC-Stäbe über der Geländeoberfläche wieder aufgenommen, um so eine Veränderung der Humusmächtigkeit zu detektieren. Alle vorgestellten Auswertungen sind auf das Jahr bezogen, da der Einbau in den Jahren 2020 und 2021 erfolgte und damit für eine gemeinsame Auswertung aller Daten nur die Jahresbasis sinnvoll ist.
Veränderung in der Humusmächtigkeit in den einzelnen Beobachtungsgebieten
Die Standorte der Humuspegel und die aus dem Projekt alpenhumus ermittelten Vorkommen von Tangelhumus in den einzelnen Beobachtungsgebieten (Ewald et al. 2020) zeigt Abbildung 2. In den 5 ausgewiesenen Alpenregionen wurden mit Ausnahme der Chiemgauer Alpen in allen Region Humuspegel verbaut.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 2: Lage der Beobachtungspunkte mit der jeweiligen Tangelhumus-Verbreitung im bayerischen Alpenraum (Ewald et al. 2020) sowie der jährlichen Humusveränderung. (© LWF)
Die Berchtesgadener Alpen weisen mit 19 % den höchsten Tangelhumusanteil auf. Gleichzeitig ist dort auch die größte Humusveränderung festzustellen, im Mittel – 0,3 cm pro Jahr. Das Lattengebirge, in welchem die Berchtesgadener Pegel verbaut wurden, war stark vom Sturm Kyrill betroffen. Durch diesen Sturm wurden große Teile entwaldet, wodurch der Waldboden erhöhter Sonneneinstrahlung und damit höheren Temperaturen ausgesetzt wurde. Durch die erhöhte Einstrahlung kam es zu einem verstärkten Abbau von Humus. Zwar wurden dort nicht nur Kalamitätsflächen, sondern auch Bestände mit Humuspegeln versehen, dabei handelte es sich aber um lichte, durch den Sturm geschädigte bzw. sich auflösende Bestände.
Im Mangfallgebirge wurden die Humuspegel in der Langenau verbaut, einem Gebiet, welches hauptsächlich durch ungestörten Laub- bzw. Bergmischwald geprägt ist. Der Tangelhumusanteil beträgt in diesem Alpenbereich 7 %, der Mittelwert der Humusveränderung im Beobachtungsgebiet liegt bei –0,05 cm pro Jahr.
Mit 13 % Anteil findet man im Werdenfelser Land relativ viel Tangelhumus. Über die letzten 3 Jahre wurde dort im Mittel eine jährliche Humusveränderung von –0,15 cm aufgenommen. Ähnlich verhält es sich in den Allgäuer Alpen, wo in den untersuchten Beständen ein mittlerer jährlicher Humusverlust von 0,11 cm zu beobachtet ist. Die Humusmächtigkeit nimmt also in allen betrachteten Gebieten ab, ist aber standortsabhängig.
Entwicklung der Humusmächtigkeit über alle Beobachtungsgebiete hinweg
In der Gesamtbetrachtung zeigen sich bei 138 Pegeln (40 % der 2024 noch vorhandenen Pegel) keine größeren Veränderungen der Humusmächtigkeit (0 ± 0,125 cm/a). Bei 49 Pegeln (15 %) konnte eine Zunahme und bei 153 (45 %) eine Abnahme der Humusmächtigkeit festgestellt werden. Im Mittel über alle Pegel liegt die Humusveränderung bei –0,14 cm pro Jahr. Das Maximum des Humuszuwachses ist bei +0,75 cm pro Jahr und der größte Humusschwund bei –1,50 cm pro Jahr zu finden. Insgesamt zeigt sich damit eine klare Tendenz zur Abnahme der Tangelhumusmächtigkeit in den bayerischen Kalkalpen.
Jährliche Veränderung der Humusmächtigkeit nach Bestandestypen
Zur Bewertung der jährlichen Humusveränderung wurden die beim Einbau gemessenen Mächtigkeiten verwendet, welche in die drei Klassen < 30 cm, 30–60 cm und > 60 cm eingeteilt wurden (Abbildung 3). Bei den Kalamitätsflächen wurde auf die Darstellung der Werte in der Klasse > 60 cm verzichtet, da sich in dieser Klasse nur zwei Pegel befinden. Es fällt auf, dass bei allen drei Bestandestypen in jeder Humusmächtigkeitsklasse der Anteil der Pegel mit Schwund den Anteil derer mit Zuwachs deutlich überwiegt. In der Mächtigkeitsklasse 30–60 cm ist der Humusabbau für alle 3 Bestandestypen (Bergmischwald, Fichtenreinbestand, Kalamitätsflächen) statistisch signifikant, auf der Freifläche zusätzlich auch in der Mächtigkeitsklasse < 30 cm. Besonders kritisch ist die Situation auf den Kalamitätsflächen und hier besonders auf den Standorten mit einer Humusmächtigkeit < 30 cm, da diese im Mittel jährlich 2,3 % ihrer Stärke verlieren. Im Extremfall beträgt hier der jährliche Humusschwund mit –1,00 cm sogar 7 %. Ähnliche Beobachtungen wurden im Höllengebirge (Oberösterreich) gemacht, wo nach einem Windwurf mit Borkenkäferbefall in den ersten drei Jahren ein Humusschwund von 0,9 cm/Jahr beobachtet wurde (Göttlein et al. 2014).
| Humusmächtigkeit beim Einbau | Anteil Pegel mit Schwund | Anteil Pegel mit Zuwachs |
|---|
| cm | ∆ <-0,125 cm/a | ∆ >0,125 cm/a |
|---|
| Bergmischwald | | |
|---|
| < 30 | 30% | 23% |
|---|
| 30–60 *** | 41% | 13% |
|---|
| > 60 | 40% | 20% |
|---|
| Fichtenreinbestand | | |
|---|
| < 30 | 31% | 16% |
|---|
| 30–60 *** | 53% | 13% |
|---|
| > 60 | 40% | 20% |
|---|
| Kalamitätsflächen | | |
|---|
| < 30 *** | 93% | 0% |
|---|
| 30–60 ** | 77% | 8% |
|---|
| > 60 | | |
|---|
Irrtumswahrscheinlichkeit: ** p<0,01 *** p<0,001
Abb. 3: Auswertung der jährlichen Humusveränderung; klassifiziert nach den beim Einbau der Pegel bestimmten Humusmächtigkeiten und den vorgefundenen Bestandestypen; statistische Auswertung mit dem nichtparametrischen Wilcoxon Test: gekennzeichnete Tiefenstufen zeigen eine von Null signifikant verschiedene Änderung der Humusmächtigkeit.
Schwierigkeiten und Probleme
Von den ursprünglich 405 eingebauten Humuspegeln konnten 2024 noch 340 vermessen werden, was 84 % entspricht. Ein Grund für das Fehlen von Pegeln ist, dass diese teilweise durch Hiebsmaßnahmen oder Wegebau zerstört wurden.
Besonders an steileren Hanglagen wirken die eingebauten Pegel als kleines Hindernis, welches die natürliche Hangabwärtsbewegung frisch gefallener Streu behindert. Ein Teil der gemessenen Humusakkumulation ist auf diesen Effekt zurückzuführen, so dass an derartigen Standorten die Humuspegel ein tendenziell zu positives Bild vermitteln.
Handlungsempfehlungen
Tangelhumusstandorte sind gefährdet, besonders wenn sie durch Katastrophenereignisse (Sturm, Borkenkäfer) oder auch im Zuge der Bewirtschaftung ihren Waldbestand (teilweise) verlieren. Um die Humusauflage und damit die Waldfähigkeit dieser Standorte so gut wie möglich zu erhalten, sind Dauerwaldstrukturen anzustreben, welche durch plenterartigen Aufbau eine möglichst breite Altersstruktur aufweisen. So kann die Störungsanfälligkeit minimiert werden. Bei dafür notwendigen Durchforstungsmaßnahmen sollte so viel Biomasse wie möglich im Bestand verbleiben. Angepasste Wildbestände sind eine Voraussetzung, um die Bestände zukunftsfähig zu verjüngen.
Zusammenfassung
Steigende Temperaturen führen zu einer erhöhten Mineralisierung und damit zu einem Abbau des alpinen Tangelhumus. Wenn auch im Mittel die beobachteten Veränderungen gering erscheinen mögen, so sind die im Bergmischwald, in Fichtenbeständen und vor allem auf den Kalamitätsflächen maximalen Werte des Humusschwundes besorgniserregend. Besonders auf Standorten, die heute schon eine geringe Humusauflage aufweisen (< 30 cm), führen jährliche Abbauraten zwischen 2,7 und 7,1 % schon in relativ kurzer Zeit dazu, dass die Waldfähigkeit dieser Standorte extrem gefährdet ist. Bei der Bewirtschaftung von Tangelhumusstandorten muss daher der Humusschutz oberste Priorität einnehmen. Die Wälder sollten also möglichst geschlossen gehalten und zugleich auf eine ausreichende und zukunftsfähige Verjüngung geachtet werden.
Literatur
- Ewald, J.; Prietzel, J.; Göttlein, A. (2020): ALPENHUMUS - Alpenhumus als klimasensitiver Kohlenstoffspeicher und entscheidender Standortsfaktor im Bergwald. Forstliche Forschungsberichte München Nr. 220, Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan, Freising.
- Göttlein, A.; Katzensteiner, K.; Rothe, A. (2014): Standortsicherung im Kalkalpin - SicALP. Abschlussbericht zum Forschungsprojekt INTERREG BY/Ö J00183. Forstliche Forschungsberichte München Nr. 212, Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan, Freising.
Beitrag zum Ausdrucken
Weiterführende Informationen
Autoren
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden