LWF aktuell 153
Kreislaufwirtschaft im Energieholzsektor: Möglichkeiten und Grenzen
von Katharina Wendel, Markus Riebler, Elke Dietz, Frauke Pampe und Herbert Borchert
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 1: Dachprofilartig aufgeschütteter Holzhackschnitzel-haufen. (© N. Hofmann, LWF)
Holzhackschnitzel sind inzwischen zu einem bedeutenden Produkt der Forstwirtschaft geworden. In Bayern werden aus 14 % der eingeschlagenen Holzmenge Hackschnitzel erzeugt. Die Prozesskette von der Herstellung über die Aufbereitung und Bereitstellung läuft mittlerweile in allen Waldbesitzarten zumeist professionell, effizient und relativ schonend ab. Fehlende Kenntnisse und bisher ungenutzte Potenziale finden sich jedoch bei der Nutzung von Reststoffen aus der Hackschnitzelaufbereitung. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt sich die Frage nach einer möglichen Rückführung anfallender Reststoffe in die Waldbestände oder deren Weiterverwendung beispielsweise in der Landwirtschaft oder im Gartenbau. Im Projekt „RestUse" der LWF wurden neue Nutzungsansätze und Verwertungsmöglichkeiten für Hackschnitzelreststoffe identifiziert, bewertet und praktisch getestet.
Im Zuge des technischen Fortschritts beim Anlagenbau von Heiz(kraft)werken sowie durch eine Professionalisierung der Brennstoffbereitstellung ist das Qualitätsbewusstsein in der Holzenergiebranche in der jüngeren Vergangenheit gestiegen. Vor allem kleine Feuerungen (>100 kW) benötigen eine konstante und definierte Brennstoffqualität für eine effiziente und emissionsarme Verbrennung (Kuptz et al., 2015; Geisen et al., 2017). Gesetzliche Anforderungen an das Emissionsverhalten von Holzfeuerungen sowie das Bedüfnis der Anlagenbetreiber nach einer hohen Betriebssicherheit setzen eine hohe Brennstoffqualität voraus. Um die spezifischen Qualitätsansprüche erfüllen zu können, durchlaufen Holzhackschnitzel aus dem Wald nach dem Hacken zunehmend zwei Aufbereitungsschritte: Trocknung und Siebung. Bei der Siebung fallen dann entsprechende Mengen an Siebresten an.
Aktuelle Nutzung und Vermarktung von Hackschnitzelreststoffen
Im Rahmen des Projektes „RestUse" gaben in einer bundesweit durchgeführten Umfrage 39 Aufbereitungsbetriebe von Hackschnitzeln Auskunft zur betriebsinternen Aufbereitung und Verwendung von Siebresten. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Großteil der befragten Unternehmen als technische Aufbereitung die Hackschnitzel sowohl sieben als auch trocknen. Die 19 in Bayern ansässigen Betriebe nutzen dabei überwiegend Nadelholz aus Waldrestholz für die Siebung (55 %), während Betriebe außerhalb Bayerns Nadelholz aus Energierundholz (47 %) als Hauptsortiment verwenden.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 2: Ausbringung der Siebreste im Versuchsbestand (© K. Wendel, LWF)
Bei der Siebung entstehen häufig drei wesentliche Fraktionen: Hauptfraktion (entspricht den aufbereiteten Hackschnitzeln), Feinfraktion (entspricht den Reststoffen) und Überlängen. Die Feinfraktion, bzw. Reststoff, ist gemäß DIN EN ISO 17225 mit einer Partikelgröße < 3,5 mm definiert. Die Hauptfraktion bezeichnet somit die gröberen Partikel, gemäß genannter DIN, entsprechend > 3,5 mm bis zu einer je nach Qualitätsstufe festgelegten Maximallänge von 16 mm bis 45 mm. Die befragten Unternehmen gaben als Siebweiten für die Differenzierung zwischen Haupt- und Feinfraktion im Mittel um die 13 mm an, was deutlich größer als die zuvor genannte Definition ist und bei der entsprechenden Begriffsnutzung „Feinfraktion" zu berücksichtigen ist. Die Befragung zeigte ein heterogenes Bild der erzielten Ausbeuten der einzelnen Fraktionen je nach Siebart und Siebtechnik. Bei Betrachtung des am häufigsten angewandten Trommelsiebes fallen rund 75 % Haupt- und 17 % Feinfraktion und damit anderweitig zu verwertende Reststoffe an.
Die Ergebnisse zeigen, dass Hackschnitzelsiebreste bislang vor allem für die energetische Nutzung (41 %) und als Einstreu im Stall (23 %) verwendet werden, und wenn überhaupt, nur geringe Erlöse erzielen. Hinter der energetischen Nutzung der Siebreste steckt i.d.R. eine Verwendung in großen Feuerungsanlagen, die nicht auf qualitativ hochwertige Hackschnitzel angewiesen sind und diese Reste zu geringeren Preisen abnehmen. Rund ein Viertel der befragten Betriebe geben die Reststoffe unentgeltlich oder gar nicht weiter.
Was steckt drin – Nährstoffgehalt der Reststoffe
Um eine differenzierte Aussage zur chemischen Zusammensetzung der unterschiedlichen Hackschnitzelsortimente sowie deren Siebreste treffen zu können, wurden Elementgehalte der vier Hauptnährstoffe Phosphor, Kalium, Calcium und Schwefel mittels Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) getrennt nach Partikelgrößen analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nährstoffgehalte bei den untersuchten Elementen in kleineren Partikelgrößen höher sind. In den feineren Fraktionen finden sich oftmals Baumbestandteile mit hohen Nährstoffgehalten, wie Rinde und Nadelreste wieder, was die insgesamt hohen Elementgehalte erklärt. Insbesondere die Feinpartikel bzw. Reststoffe enthalten somit im Vergleich zur Hauptfraktion besonders viele für das Baumwachstum relevante Nährstoffe (Abbildung 3), die es – wenn möglich – zu nutzen gilt.
| Material | Phosphor | Schwefel | Kalium | Calcium |
|---|
| Ausgangsmaterial, ohne Waldrestholz | 694 | 278 | 1.266 | 4.421 |
|---|
| Feinmaterial, ohne Waldrestholz | 1.050 | 498 | 3.955 | 8.209 |
|---|
| Ausgangsmaterial, Waldrestholz | 637 | 293 | 1.454 | 4.285 |
|---|
| Feinmaterial, Waldrestholz | 780 | 418 | 2.065 | 5.865 |
|---|
Abb. 3: Vergleich der Elementgehalte in [ppm] zwischen Hackschnitzeln aus Waldrestholz und aus Nicht-Waldrestholz (Energierundholz etc.) und dessen gesiebten Feinmaterials aus Proben von Aufbereitungsbetrieben. (© LWF)
Feldversuch zur Reststoffausbringung auf nährstoffarmen Standorten
In einem Feldversuch im Rahmen des Projektes wurden die Auswirkungen der Ausbringung von Feinmaterial aus der Hackschnitzelaufbereitung auf den Ernährungszustand von Bäumen und den Boden analysiert. Dazu wurden Nadelspiegelwerte ermittelt und Bodenproben gewonnen, um Veränderungen direkt am Baum, aber auch im gesamten Ökosystem Wald zu erkennen. Als Untersuchungsgebiet wurden Waldbestände im Frankenwald (Landkreis Kronach) ausgewählt. Diese Standorte zählen zu den basenärmsten in Bayern (Schäff et al., 2016). Besonders nährstoffarmen Standorten sollten bei der Bereitstellung von Holzhackschnitzeln möglichst wenig Nährstoffe entzogen werden, sofern dies aus Waldschutzgesichtspunkten möglich ist. In diesen Regionen könnte die Ausbringung von Holzhackschnitzelreststoffen eine Möglichkeit darstellen, den Nährstoffexport auszugleichen und somit eine Alternative zur klassischen Kalk-Düngung bieten.

Abb. 5: Ausgewählter Fichtenaltbestand im Frankenwald nahe Lauenstein, Landkreis Kronach. (© K. Wendel, LWF)

Abb. 6: Ausgewählte Fichtenjungdurchforstung im Frankenwald nahe Lauenstein, Landkreis Kronach. (© K. Wendel, LWF)
Bei der Ausbringung wurden in einem ca. 75-jährigen Fichtenaltbestand (Abbildung 5) und einem rund 40-jährigen Fichtendurchforstungsbestand (Abbildung 6) jeweils fünf Ausbringungsvarianten (Kontrollfläche, Hackschnitzelsiebrest 8 mm und 16 mm, Hackschnitzelsiebrest 8 mm mit Mykhorriza sowie Kalkdünger und Holzasche) getestet. Die Gehalte an Phosphor, Kalium und Schwefel waren bei den Hackschnitzelsiebresten sogar teils deutlich höher als im Kalkdünger. Lediglich der Calciumgehalt war mit rund 37 % (äquivalent zu ca. 10 kg je 3 t) im Kalkdünger weit höher als in den Hackschnitzelsiebresten, was aufgrund des hohen Gehalts an CaO (Calciumoxid) und CaCO₃ (Calciumcarbonat) im Kalkdünger ein erwartbares Ergebnis ist (Abbildung 4).
| Variante | Phosphor | | Schwefel | | Kalium | | Calcium | |
|---|
| [%] | Menge je
3 t/ha [g] | [%] | Menge je
3t/ha [g] | [%] | Menge je
3t/ha [g] | [%] | Menge je
3 t/ha [g] |
|---|
| Kalkdünger | 0,10 | 28,98 | 0,04 | 11,76 | 0,53 | 158,58 | 36,56 | 10.969,08 |
|---|
| 8 mm Hackschnitzelsiebrest | 0,20 | 60,50 | 0,19 | 57,90 | 1,03 | 309,10 | 3,36 | 1008,00 |
|---|
| 16 mm Hackschnitzelsiebrest | 0,21 | 62,10 | 0,28 | 84,60 | 1,31 | 394,10 | 2,19 | 656,30 |
|---|
Abb. 4: Vergleich der relativen und der absoluten Elementgehalte in % bzw.
in g pro 3 t/ha Ausbringungsmenge der verschiedenen Düngevarianten
Ist ein Düngungseffekt feststellbar?
In den dargestellten Waldbeständen wurden drei Beprobungen in jeweils aufeinanderfolgenden Vegetationsperioden durchgeführt, wobei die erste Beprobung als Referenz vor der Ausbringung erfolgte. Die Referenzbeprobung zeigte für beide Untersuchungsbestände anhand der Nadeln einen latenten Mangel an Calcium und Phosphor, mittleren Mangel an Schwefel und extremen Mangel an Kalium. Die Spurenelemente Eisen, Mangan und Kupfer sind in den Nadeln im normalen Umfang enthalten, verglichen mit den ernährungskundlichen Referenzwerten nach Göttlein et al. (2011).
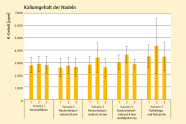 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 7: Durchschnittliche Kaliumgehalte der Nadeln im Fichtendurchforstungsbestand getrennt nach den drei Beprobungszeitpunkten (1-3) und den Ausbringungsvarianten 1 bis 5. (© LWF)
Neben der Messung der Nährstoffgehalte der Nadeln wurde das 100-Nadelgewicht als ein möglicher Indikator für eine eventuelle Nährstoffunterversorgung, für einen etwaigen Wassermangel oder für andere Stressfaktoren untersucht. Durch die Ausbringung der verschiedenen Düngevarianten konnte jedoch kein messbarer Effekt auf das Nadelgewicht in den Untersuchungsbeständen nachgewiesen werden.
Betrachtet man die Nährstoffgehalte der Nadeln über den Versuchszeitraum hinweg, zeigen sich leichte Unterschiede zwischen den Ausbringungsvarianten sowie zwischen den Beprobungszeitpunkten (vgl. beispielhaft Abbildung 7 bezogen auf die Kalium-Gehalte im Jungbestand). Allerdings zeigen sich oftmals bereits signifikante Unterschiede bei der Referenzbeprobung (1. Beprobung) vor jeglicher Ausbringung. Dies überlagert möglicherweise von der Ausbringungsvariante abhängige Veränderungen. Zusätzlich spielen Parameter wie Lage der Nadeln in der Krone (Licht- oder Schattenkrone) sowie der Nadeljahrgang an sich eine große Rolle und erschweren ebenso die Detektion eines möglichen Düngeeffektes.
Andere Studien (bspw. Borchert et. al., 2015) zeigen, dass die Mineralisierung insbesondere bei Kalium rasch abläuft. Entsprechend lässt sich vermuten, dass ein potenzieller Effekt der Ausbringung der Hackschnitzelreststoffe bezogen auf die Kaliumgehalte am schnellsten bzw. am ehesten zu beobachten ist. Signifikante Unterschiede, unabhängig von Licht- bzw. Schattenkrone oder Nadeljahrgang, konnten bei den Kaliumgehalten zum Zeitpunkt der zweiten Beprobung bei der Aufbringung von feinem Siebrest (8 mm mit Mykorrhiza (Variante 4)) sowie von Kalkdünger (Variante 5) im Vergleich zur Kontrollfläche (Variante 1) festgestellt werden. Dieser mögliche positive Effekt der Ausbringung lässt sich allerdings bei der 3. Beprobung nicht mehr feststellen.
Insgesamt konnte durch die Ausbringung der Siebreste im Feldversuch für den Fichtendurchforstungsbestand beim bereits erwähnten Kalium- sowie beim Magnesiumgehalt ein leicht positiver Effekt bei Verwendung von feinem Siebrest (bis 8 mm und unter Zugabe von Mykorhiza beim Kalium) abgeleitet werden. Beim Altbestand sind dagegen bei allen Nährstoffgehalten keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zur Kontrollfläche feststellbar. Die anfangs gemessenen Mängel bezogen auf die untersuchten Nährelemente konnten sich sowohl durch die Aufbringung der Reststoffe als auch des Kalkdüngers insgesamt nicht verbessern.
Betrachtet man die Bodenverhältnisse vor und nach Ausbringung der Varianten, zeigt sich, dass die Ausbringung von Kalkdünger gemischt mit Holzasche zu erhöhten Calcium- und Magnesium-Gehalten in der Streuauflage führt. Im Auflagehumus war jedoch kein Unterschied feststellbar. Vermutlich erfolgt die Freisetzung der Elemente zu langsam, um in der Beobachtungsdauer bereits im Auflagehumus umgesetzt zu sein. Die Ausbringung der Hackschnitzelreststoffe spiegelte sich weder in veränderten Nährelementgehalten der Humus- noch der Streuauflage wider.
Herausforderungen des Feldversuches
Der Feldversuch in der Region des Frankenwaldes sah sich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, die die Ergebnisse beeinflussten. Besonders hervorzuheben sind die veränderten mikroklimatischen Bedingungen im beprobten Altbestand nach zweijährigem Borkenkäferbefall und entsprechender Schadholzaufarbeitung. Diese Umweltfaktoren, wie Stresseinwirkung durch Käferbefall oder Witterung, könnten die Wirkung der Ausbringungsvarianten überlagert haben. Aufgrund der Käferkalamität musste der Altbestand im zweiten Versuchsjahr vollständig geräumt werden, weshalb nach Ausbringung der Substrate lediglich nach nur einer Vegetationsperiode mögliche Auswirkungen auf die Bäume untersucht werden konnten. Bei einer längeren Beobachtungsdauer hätten vielleicht doch Effekte festgestellt werden können. Nach der Studie von Borchert et al. (2015) wurde bei Fichtennadeln eine Mineralisationsrate nach einem Jahr von weniger als 20 % bei den Nährstoffen Calcium, Phosphor und Schwefel beobachtet.
Alternative Nutzungsmöglichkeiten
Die durchgeführte Marktrecherche zeigt, dass Hackschnitzelsiebreste ohne oder nur mit geringer Wertschöpfung verwertet werden. Deshalb wurden neben der potenziellen Rückführung in die Waldbestände als Dünger weitere innovative Nutzungswege beleuchtet. Die Nutzung der Reststoffe kann nicht nur ökologisch sinnvoll sein, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bieten. Die Marktanalyse zeigt auch, dass bereits fünf Unternehmen Hackschnitzelsiebreste als Mulchmaterial, Torfersatzstoff oder Ersatz für Rindenmulch im Garten- und Landschaftsbau einsetzen.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 8: Die Nutzung von Hackschnitzelsiebresten bleibt vielfach aus oder erfolgt mit lediglich geringer Wert-schöpfung. (© T. Hase)
Eine nähere Betrachtung der Eignung von Hackschnitzelsiebresten als torffreies Substrat erfolgte im Austausch mit anderen Forschungsinstituten (Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf). Ein Hauptargument für den Einsatz von Hackschnitzelsiebresten im Garten- und Landschaftsbau ist die große und kontinuierliche Verfügbarkeit des Rohstoffes als Nebenprodukt der Holzverarbeitung. Im Vergleich zu speziell produzierten Substraten oder Mulchmaterialien sind Hackschnitzelsiebreste i. d. R. kostengünstig, da sie ohnehin als Reststoff anfallen. Zudem können sie oft direkt aus regionalen Quellen bezogen werden, was Transportwege und damit verbundene CO2-Emissionen reduziert. Dies macht sie zu einer umweltfreundlichen Option, insbesondere gegenüber torfhaltigen Substraten. Die potenziell langsamere Zersetzungszeit des Siebrestes könnte langfristig zur Bodenverbesserung beitragen, indem sie organisches Material und Nährstoffe konstant freisetzen. Insbesondere die Heterogenität des Ausgangsmaterials und die Lagerungsbedingungen machen jedoch eine einheitliche Nutzung als Substrat schwierig. Es bedarf somit weiterer Forschung und Tests, um die optimalen Einsatzmöglichkeiten und -bedingungen festzulegen. Einfacher einsatzbar könnten die Hackschnitzelsiebreste für Bereiche sein, bei denen die chemische Zusammensetzung und Homogenität eine untergeordnete Rolle spielen (z. B. als Fallschutz auf Spielplätzen, als Bodenabdeckung oder Kompostzugabe).
Anhand eines Praxisbeispiels wurde die Einsatzmöglichkeit der Reststoffe als Einstreu in der landwirtschaftlichen Tierhaltung erörtert. In diesem Fall handelte es sich um einen Kompostierstall, welcher mit Hackschnitzelsiebresten aus Eigenproduktion eingestreut wird. Die Nutzung der Siebreste kann dabei sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile bieten. Die Nutzung der Reststoffe als Einstreu stellt hierbei eine höherwertige Verwendung da, dient dem Tierwohl und der entstehende Kompost kann als Dünger weiterverwendet werden, wodurch weniger Mineraldünger für die landwirtschaftlichen Flächen zugekauft werden muss. Diese entstandene »Kreislaufwirtschaft« kann jedoch nicht ohne weiteres auf andere landwirtschaftliche Betriebe übertragen werden. Voraussetzungen sind hierfür v.a. kurze Transportwege und eine regionale Holzherkunft, wie sie in einem kombinierten Forst- und Landwirtschaftsbetrieb mit entsprechender Holzverarbeitung und Stallhaltung bestehen.
Eine potenzielle anderweitige Verwendungsmöglichkeit der Hackschnitzelsiebreste besteht in der Gewinnung von Extraktstoffen. Die Siebreste könnten dabei als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen, oft fossilen Rohstoffen, zum Einsatz kommen. Insbesondere in Kombination mit modernen Extraktionsverfahren eröffnen sich dadurch möglicherweise wirtschaftlich attraktive und ökologische Anwendungsbereiche, die das Konzept der Kreislaufwirtschaft stärken und gleichzeitig eine höherwertige Nutzung garantieren könnten. Hier bedarf es allerdings weiterer Forschung.
Literatur
- BORCHERT, H.; HUBER, C.; GÖTTLEIN, A.; KREMER, J. (2015): Nutrient Concentration on Skid Trails under Brush-Mats – Is a Redistribution of Nutrients Possible? Croat. j. for. eng. 36 (2015) 2. https://crojfe.com/site/assets/files/4016/borchert.pdf
- GEISEN, B., GIVERS, F., KUPTZ, D., PEETZ, D., SCHMIDT-BAUM, T., SCHÖN, C., SCHREIBER, K., SCHULMEYER, F.,THUDIUM, T., ZELENSKI, V., ZENG, T. (2017): Handbuch zum Qualitätsmanagement von Holzhackschnitzeln. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR). Gülzow-Prüzen. S. 34
- GÖTTLEIN, A., BAIER, R., MeELLERT, K.H.(2011): Neue Ernährungskennwerte für die forstlichen Hauptbaumarten in Mitteleuropa – Eine statistische Herleitung aus van den Burg`s Literaturzusammenstellung. Allg. Forst- u. J.-Ztg. 182, 173-186
- KUPTZ, D., SCHULMEYER, F., HÜTTL, K., DIETZ, E., TUROWSKI, P., ZORMAIER, F., BORCHERT, H., HARTMANN, H.(2015): Optimale Bereitstellung für Holzhackschnitzel. TFZ Berichte 40. Technologie- und Förderzentrum (TFZ). Straubing, S. 41.
Beitrag zum Ausdrucken
Weiterführende Informationen
Autoren
- Fauke Pampe
- Markus Riebler
- Dr. Elke Dietz
- Katharina Wendel
- Dr. Herbert Borchert
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
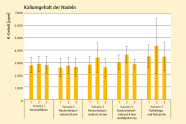 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden





